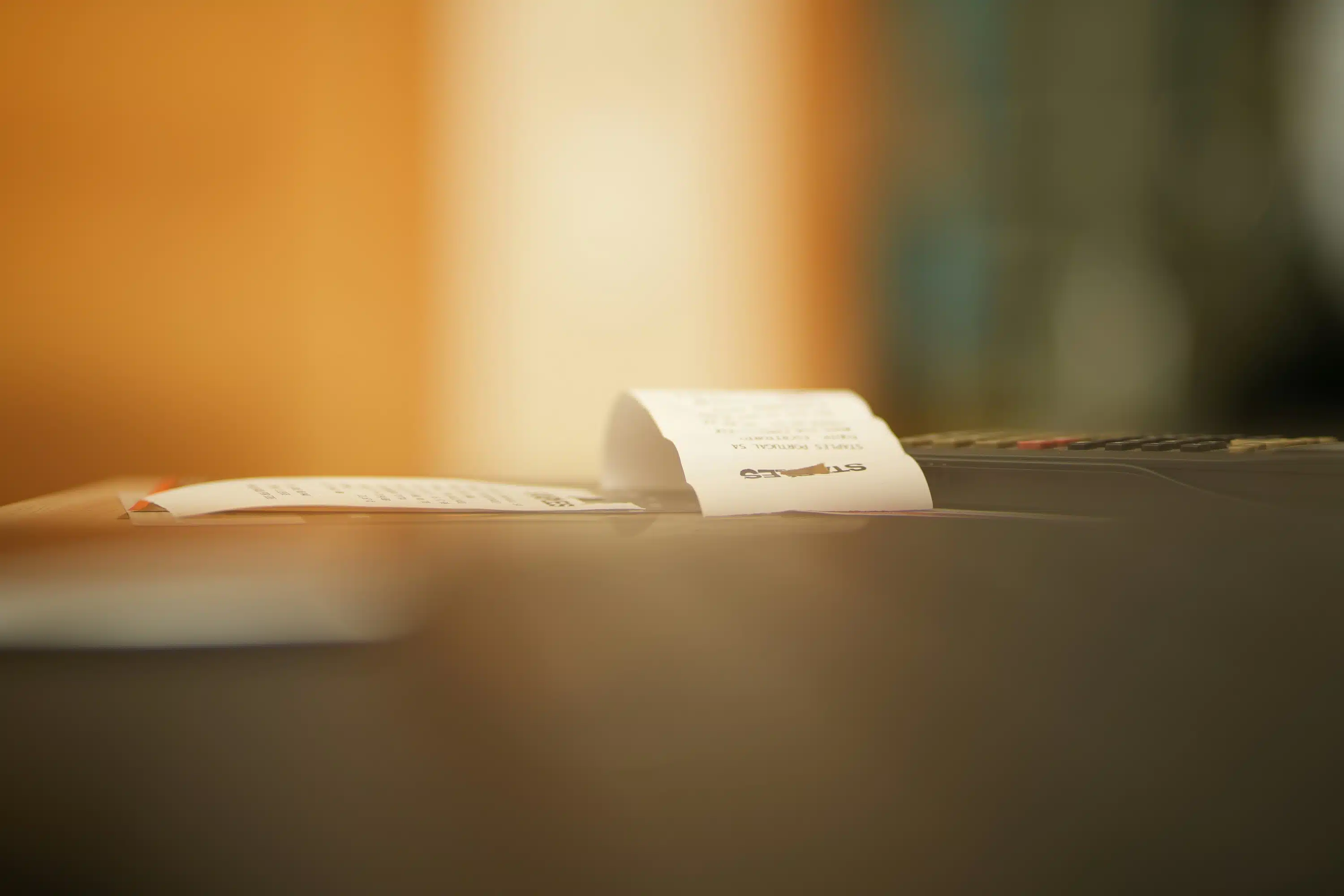Ein unberechtigter Schufa-Eintrag stellt eine Datenschutzverletzung dar und führt zu einem Schadenersatz von 1.500,- €. Diesen sprach das OLG Dresden dem Betroffenen zu (Beschluss v. 29.08.2023, Az.: 4 U 1078/23). Es bestätigte damit ein Urteil des Landgerichts Leipzig.
Besteht ein unberechtigter, negativer Schufa Eintrag kann nicht nur dessen Entfernung, sondern regelmäßig auch Schadensersatz, bzw. Schmerzensgeld gefordert werden. Auch die Kosten der anwaltlichen Vertretung sind in diesem Zusammenhang zu erstatten. Weitere Informationen dazu haben wir hier dargestellt: Schufa Eintrag löschen lassen.
Schufa Eintrag im Bilde der DSGVO
Die Wirtschaftsauskunftei Schufa Holding AG hatte grob fahrlässig einen Fehleintrag zu den Schuldenverhältnissen des Betroffenen – einem sächsischen Bürger mit Nebengewerbe – vorgenommen und den Negativeintrag sechs Monate lang nicht gelöscht. Der Betroffene musste deshalb unter anderem mit einer stufenweisen Reduktion seines Dispositionsrahmens und schließlich sogar mit einer Kündigung seines Girokontos leben.
Aufgrund der dem Eintrag zu gründe liegenden Datenverarbeitung stellt der negative Schufa-Eintrag einen DSGVO-Verstoß dar. Der Betroffene forderte daher vor dem LG Leipzig Schadenersatz nach Artikel 82 Abs. 1 DSGVO und bekam vom Gericht Schadensersatz von 1.500,- € zugesprochen.
Damit gab er sich nicht zufrieden und legte beim OLG Dresden Berufung ein. Nach seiner Auffassung war der erlittene immateriellen Schaden höher. Immer hatte der Fehleintrag bei der Schufa zu echten Existenzängsten geführt, die das Landgericht stärker berücksichtigen sollte. Diese Berufung hatte indes keinen Erfolg. Zwar bestätigte das OLG Dresden das Recht auf Schadenersatz in der genannten Höhe, verwies aber auf das korrekte Urteil der ersten Instanz.
Grundsätze zum Schadensersatz nach der DSGVO und einem Schufa-Eintrag
Die Gründe für eine Schadensbemessung bei einem DSGVO-Datenschutzverstoß sind unter anderem im Erwägungsgrund 146 Satz 3, aber auch in der jüngeren Rechtsprechung des EuGH zu finden.
Es sind bei solchen Verstößen durchaus Faktoren wie Stress, Angst, Komfort- und Zeiteinbußen sowie eine potenzielle Rufschädigung und Stigmatisierung von Betroffenen zu berücksichtigen. Dies habe allerdings das erstinstanzliche Gericht auch getan, so die Richter am Berufungsgericht. Das Urteil sei daher in äquivalenter Übereinstimmung zur entsprechenden nationalen Rechtsprechung gefällt worden.
Einen Verstoß gegen unionsrechtliche Grundsätze der Effektivität und Äquivalenz konnte das OLG Dresden ebenfalls nicht feststellen. Die Kollegen am LG Leipzig hätten vielmehr bei ihrer Schadensbemessung die Rufschädigung des Betroffenen gegenüber seinen eigenen Kunden, seine Unannehmlichkeiten wegen der Kontokündigung und weitere Komforteinbußen angemessen berücksichtigt.
Des Weiteren habe das erstinstanzliche Gericht auch die Bedeutung der Erwerbstätigkeit und zeitliche Aspekt bei seiner Bemessung gewürdigt. Die Bank hatte zunächst den ursprünglichen Dispositionsrahmen von 13.700 € Monat für Monat um 500 € abgesenkt. Erst nach rund 27 Monaten bestand fast kein Disposionsrahmen mehr. Der Kläger hatte mithin ausreichend Zeit, um der Absenkung entgegenzuwirken.
Auch zwischen der Mitteilung am 13.07.2022, dass man sein Girokonto kündigen werde, bis zum Inkrafttreten der Kündigung am 18.09.2022 verging noch etwas Zeit. Der Kläger hatte argumentiert, dass er in einen existenziellen Druck geraten und gezwungen gewesen sei, seine Konten „über Nacht“ umzudisponieren. Diesem Argument konnten beide Gerichte nicht folgen. Ein wichtiger Aspekt war für den Beschluss der Dresdner Richter, dass der Betroffene sein Gewerbe nur nebenberuflich ausübt und daher nicht von echten Existenzsorgen betroffen war.
Immaterieller Schadenersatz mit generalpräventiver Funktion
Der im Artikel 82 DSGVO festgelegt Schadenersatz soll generalpräventiv wirken. Insofern ist das Urteil wichtig, auch wenn sich der Kläger eine höhere Schadenersatzsumme vorgestellt hat.
Gegen die Schufa liefen wegen ihrer falschen Einträge schon etliche Prozesse, in denen sie praktisch komplett unterlag. Die Intention des Artikels 82 DSGVO ist zunächst, dass der Schadenersatz den Verursacher durchaus empfindlich trifft.
Im vorliegenden Fall hatte die Schufa dem Schuldner fälschlicherweise rund 3.000 € nicht beglichener Schulden unterstellt. Ein Schadenersatz, der die Hälfte dieser Summe ausmacht, ist nach Auffassung beider Gerichte ausreichend hoch. Zwar hatte der Kläger auf andere einschlägige Urteile zu falschen Schufa-Einträgen hingewiesen, bei denen die Betroffenen höhere Schadenersatzsummen erhalten hatten. Er zitierte unter anderem ein Urteil, bei dem einem anderen Betroffenen wegen der massiven Beeinträchtigung des sozialen Ansehens durch einen fehlerhaften Schufa-Eintrag 5.000 Euro Schadenersatz zugesprochen worden waren.
Dieser Fall hatte wahrscheinlich anders gelegen, wäre ein höherer Schaden zu vermuten. Der Kläger trug dieses Argument nur pauschal und ohne Verweis auf ein Aktenzeichen vor, weshalb sich das Beispiel nicht konkretisieren ließ. Daher urteilten / beschlossen beide Gerichte, dass im vorliegenden Fall eine Schadenersatzsumme von 1.500 € angemessen ist.